Erschienen in der Fachzeitschrift „RC&A, Risk, Compliance & Audit“.
Ausgabe 1/2011
Changemanagement in der Internen Revision
„Vision trifft Tradition“ – Wie Sie den Weg durch die Veränderung vom traditionellen zum modernen Revisionsverständnis professionell gestalten.
Menschen und Organisationen sind "eigenständige Systeme", die sich in der Regel "von außen wenig reinreden lassen". Sie verändern sich gemäß ihres Selbstbildes mit den Potenzialen, die sie bei sich erkennen. Allein in diesem Rahmen liegt die Chance auf Veränderung und auf Entwicklung neuer Lösungen.
Eine der zentralen Aufgaben des Managers in der Internen Revision ist die vorausschauende, strategische Ausrichtung seines Verantwortungsbereiches bzw. die nachhaltige Weiterentwicklung vom traditionellen zu einem modernen Revisionsverständnis. Dies im Spannungsfeld zwischen der bisherigen, etablierten Arbeitsweise und den neuen Anforderungen des Marktes. Eine Herausforderung steht dabei in besonderem Fokus, die nachweislich für Erfolg oder Misserfolg von Veränderungsprozessen steht:
Der Aufbau einer dynamischen Veränderungskultur. Denn jeglicher Changeprozess erfordert vor allem auch eine Veränderung des Bewusstseins -im Rahmen der Möglichkeiten des „eigenständigen Systems“- und entwickelt sich zu einem hoch emotionalen Miteinander.
- Der emotionale Verlauf im Changeprozess
Bereits in den achtziger Jahren entdeckte die Boston Consulting Group dazu einen systematischen und vorhersagbaren Verlauf der Stimmung während Changeprozessen und entwickelte die „Change Curve“ (Klimakurve) als emotionalen Verlauf von Veränderungsprozessen. Danach sind sowohl Krisen als auch rasante Fortschritte in Changeprojekten nicht zufällig verteilt, sondern treten bevorzugt in ganz bestimmten Projektphasen auf. 1 Hier zwei Varianten als vereinfachte Darstellung:
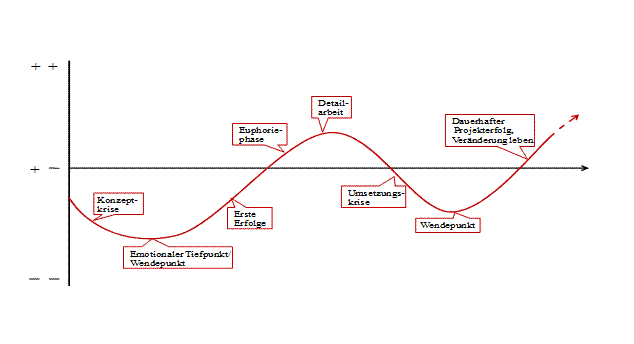
Abb. 1: „Change Curve“/Klimakurve1
Nach diesen Zyklen lassen sich die Gefahrenstellen während eines Entwicklungsprozesses relativ leicht erkennen: Die Euphorie-Phasen (wie in der Erfolgsphase) mit Neugierde, Spannung, Hoffnung evtl. Selbstüberschätzung, da einem ohnehin alles gelingt. Die Krisenphasen (wie in der Konzeptkrise) mit problemorientierten Denkmustern bis hin zur destruktiven Fehlersuche.
Mit dem Wissen um diesen typischen Verlauf, können Sie Talsohlen und mögliche Krisen einfacher vorhersehen und erforderliche Maßnahmen für den Turnaround gezielter ableiten.
Ob der Startpunkt der Klimakurve von einer optimistischen oder einer pessimistischen Haltung gekennzeichnet ist, hängt stark von der Veränderungsbereitschaft der MitarbeiterInnen ab.
Gemischte Gefühle bei den Beteiligten gerade am Beginn eines Veränderungsprojektes sind also nicht ungewöhnlich. Je nachdem ob die Erfahrung mit vorangegangenen Projekten positiv oder negativ war, startet ein Change mit einer Bandbreite von anfänglichem Abwarten über freudigkonstruktive Erwartung bis hin zu einer destruktiven Verweigerungshaltung.
Bedenken werden jedoch in aller Regel nicht offen ausgesprochen (Es lebe der Flurfunk!) – wirken sich aber emotional erheblich auf das Veränderungsklima aus.1
Ein Erfahrungswert aus der Veränderungspraxis möge den Fokus der Emotionalität belegen:
Der Changeprozess einer Internen Revision war u.a. von der Forderung nach einer erhöhten Risikoorientierung gekennzeichnet. Gleichzeitig gab es aufgrund negativer Erfahrungen mit einem vormals gescheiterten Changeprojekt bereits zu Beginn erhebliche Vorbehalte. Noch bevor man hätte eine erste Euphorie als Startschuss für die Veränderung nutzen können, waren erste Zweifel an dem neuen Konzept gefunden und wurden immer lauter pro-pagiert (Konzeptkrise). Verunsicherung machte sich in der Mannschaft breit…
Das emotionale Dilemma dabei:
Um künftig risikoorientierter agieren zu können, bedurfte es jedoch eines Bewusstseins der Stärke mit einem mutigeren Auftreten ggü. den Fachbereichen. Erforderlich war die erhöhte Konzentration auf das Wesent-liche (auf die Risiken), und dieses in Meilenstein- und Abschlussgesprächen im Klartext konstruktiv zu benennen…
Erst durch ein bewusstes Herbeiführen des kollektiven Sich-Luftmachens und durch das Benennen und Ernstnehmen(!) der Bedenken und Befürchtungen war „die Luft einigermaßen bereinigt“. Erst jetzt konnte die Klärung des Veränderungsrahmens beginnen (s.u. Abb.2) und später ein erstes, gemeinsames Zielbild entwickelt werden…
Eine spannende Besonderheit in der Startphase von Veränderungen in der Internen Revision:
In der Regel sind RevisorInnen mit den Fähigkeiten zur messerscharfen Analyse und zum treffsicheren Erkennen bestehender Mängel ausgestattet. Gerade diese Kernkompetenzen können bereits im Vorfeld eines Changemanagementprozesses dazu führen, dass eher nach den Problemen, denn nach Chan-cen und Lösungen „geforscht“ wird.
Dieser erste Exkurs aus der Praxis lässt bereits erahnen, dass Veränderung nur mit einer professionellen Strategie gelingen kann. Das nachfolgende Vier-Säulen-Schema, als strategische Grundlage, die einerseits Orientierung und Sicherheit für einen durch viele Unsicherheiten gekennzeichneten Prozess gibt. Andererseits den Rahmen für eine hohe Flexibilität stellt.
1 Vgl. Winfried Berner und Kollegen, die Umsetzungsberatung:
Change Guide, eine Veränderungsstrategie entwickeln. Quelle: www.umsetzungsberatung.de/veränderungsstrategie/klimakurve
2. Das Vier-Säulen-Schema der Veränderungsstrategie
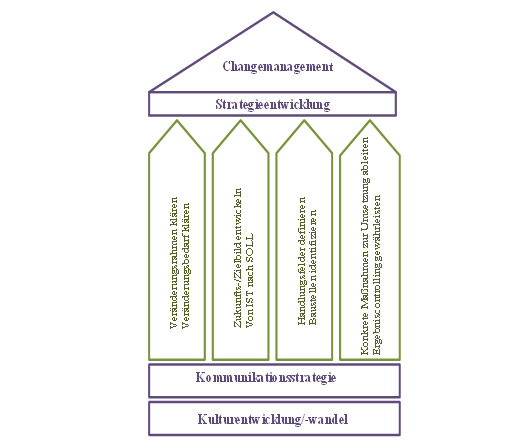
Abb. 2: Vier-Säulen-Schema „Changemanagement“, Quelle: www.dietmar-jakobi.de/downloads
2.1 Vier-Säulen-Schema Phase 1: Veränderungsrahmen und Veränderungsbedarf klären
In Phase 1 beleuchten Sie Vision und Ziele Ihres Gesamtunternehmens und klären den aktuellen Beitrag der Revision sowie die Erwartungen, die der Vorstand/die Geschäftsleitung an Ihren Verantwor-tungsbereich hat. Darüber hinaus sollten Sie sich Klarheit über den Veränderungsbedarf durch eine angemessen umfangreiche Analyse verschaffen. Nicht alle internen und externen Reaktionen sind vorhersehbar. Je genauer Sie diese einschätzen können desto treffsicherer können Sie die kritischen Punkte identifizieren und Ihre Veränderungsstrategie entwickeln.
Ob Sie mit den Schlussfolgerungen aus Ihrer Analyse richtig liegen, wird sich im Verlauf des Changeprozesses zeigen. Die Zahl unangenehmer Überraschungen lässt sich aber deutlich reduzieren, wenn Sie sich vorab folgende Fragen stellen:
2.1.1 Klärende Fragen zum Veränderungsrahmen und zum Veränderungsbedarf, wie z.B.:
• Welche Vision hat das Unternehmen?
• Welche Ziele hat das Unternehmen?
• Welchen Beitrag leisten wir aktuell dazu?
• Was ist der Anlass für die Veränderung?
• Was soll wirklich verändert werden?
• Welche Revisionsbereiche/-mitarbeiter sind in welchem Ausmaß betroffen?
• Welche Bereiche der Revision werden von den geplanten Veränderungen direkt betroffen sein?
• Wie viele meiner Mitarbeiter werden beteiligt sein?
• Was konkret soll / wird sich für diese Mitarbeiter ändern?
2.1.2 Klärende Fragen zu bisherigen Erfahrungen mit Changeprojekten:
Ein neues Veränderungsprojekt startet niemals bei einem neutralen Nullpunkt.
Daher ist es sehr empfehlenswert, im Vorfeld offen zu klären, was die Betroffenen ohnehin unausge-sprochen mit sich tragen. Je gravierender die Ver-änderung, desto größer die Rolle der Emotionen!
Gerade in den Revisionseinheiten, die Veränderung nicht gewohnt sind, können bereits scheinbar gerin-ge Veränderungen bei dem einzelnen -je nach Mentalität und persönlicher Situation- größte Bedenken auslösen und sich sogar in Ängsten manifestieren. Legen Sie in dieser Phase bewusst nicht Ihre Bewertung an. Die Sichtweisen Ihrer Mitarbeiter wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine andere sein. Schon allein aus der Rollenkonstellation heraus, in der Veränderung eher Getriebener, denn der Treiber zu sein. Und Ängste, die nicht ernstgenommen werden bzw. nicht beseitigt werden können, schlagen häufig in eine aggressive Grundhaltung und anschlie-ßend in Resignation um. Eine scheinbar fehlende Veränderungsdynamik mit Widerständen und dem beharrlichen Festhalten am Altbewährten ist oft nichts anders, als die Angst, den künftigen Anforde-rungen nicht gewachsen zu sein2.
Tipp: Geben Sie Kritik ausreichend Raum! Finden Sie frühzeitig heraus, was die beteiligten Personen mit der bevorstehenden Veränderung assoziieren! Begreifen Sie auftretende Widerstände als Chance!
Die Chance, die Qualität der Veränderung zu stärken. In der Auseinandersetzung mit Widerständen beflügeln Sie die Veränderungsdynamik. Treten Sie diesen offen gegenüber, fördern Sie die Identifikation Ihrer Mitarbeiter und erhöhen die Akzeptanz. „Bügeln Sie die kritischen Stimmen ab“, nehmen Sie eine dauerhafte Blockadehaltung in Kauf.
2.1.3 Klärende Fragen, um die Reaktionen Ihrer Mitarbeiter auf die bevorstehenden Veränderungen abzuschätzen (auch da wird es im späteren Verlauf Überraschungen geben):
• Welche positiven/negativen Erfahrungen haben Sie mit vorangegangenen Veränderungsprozessen gemacht?
• Welche Erwartungen ergeben sich daraus an unser bevorstehendes Projekt?
• Was darf in diesem Projekt auf keinen Fall passieren?
• Wie einschneidend werden die Veränderungen voraussichtlich in der subjektiven Sicht der Mitarbeiter sein?
• Wie werden Sie mit den Erwartungen/Bedenken Ihrer Mitarbeiter umgehen?
• Wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft in der Mannschaft?
• Wie hoch ist die Veränderungsfähigkeit in der Mannschaft?
2 2 Vgl. Winfried Berner und Kollegen, die Umsetzungsberatung:
Change Guide, eine Veränderungsstrategie entwickeln. Quelle: www.umsetzungsberatung.de/veränderungsstrategie/klimakurve
2.1.4 Klärende Fragen zum Umfeld (Kunden/Schnittstellen):
Erfahrungsgemäß reagiert auch das Umfeld je nach Art der Veränderungen und eigener Interes-senlage sehr unterschiedlich: Von beiläufiger Kenntnisnahme bis hin zu heller Aufregung ("Um Himmels willen, wollen die jetzt tatsächlich unsere Leichen aus dem Keller holen?!").
• Welche Auswirkungen haben unsere Veränderungen auf welche Unternehmensbereiche, Fachabteilun-gen, Organisationseinheiten?
• Welche Einheiten sind die Hauptbetroffenen?
• Was genau soll und wird sich für sie ändern?
• Welche „innenpolitischen Gegebenheiten“ sollten wir beachten?
Tipp: Nehmen Sie dazu ein aktuelles Organigramm Ihres Unternehmens und markieren Sie dort zunächst mit einem Leuchtmarker die Bereiche, die von den Veränderungen unmittelbar betroffen sein werden. Dann nehmen Sie einen andersfarbigen Marker und streichen all die Bereiche an, auf die die Veränderungen vermutlich abstrahlen werden (beachten Sie dabei auch die politischen Seilschaften im Unternehmen/zwischen Ihren internen Kunden). So können Sie auf einen Blick erkennen, welche Kreise Ihr Veränderungsprojekt mittelbar und unmittelbar ziehen wird und welchen Widerständen Sie und Ihre Mitarbeiter möglicherweise ausgesetzt sein werden.
Erst nach dieser umfangreichen Analyse, und Ihrer sichtbaren Reaktion auf die Erkenntnis daraus, leiten Sie die Phase 2 ein.
2.2 Vier-Säulen-Schema Phase 2: Zukunfts-/Zielbild entwickeln
(Der Weg von IST nach SOLL)
Eine motivierende Vision mit klar definierten, um-setzbaren Zielen sind elementare Voraussetzungen, um sich auf den Weg zu machen. Bevor Sie dazu Fragen stellen, sollten Sie entscheiden, welche Ziele Sie vorgeben und welche Ziele tatsächlich gemeinsam entwickelt werden.
Klärende Fragen:
• Welche Faktoren kennzeichnen unsere aktuelle Situation?
• Was genau wollen/müssen wir verändern?
• Welche konkreten Ziele definieren wir daraus?
• Welche Chancen, welche Risiken sehen wir?
• An welchen Kriterien werden wir später erkennen, dass wir unsere Ziele erreicht haben?
2.3 Vier-Säulen-Schema Phase 3: Handlungsfelder definieren, Baustellen identifizieren
Um die für die Zielerreichung relevanten Hand-lungsfelder zu bestimmen und die Baustellen zu identifizieren, ist eine wertschätzende und lösungsorientierte Grundhaltung (statt Schuldzuweisungen zu verteilen) erforderlich.
Klärende Fragen:
• Welche Themen werden, welche Baustellen müssen wir bearbeiten (strukturell, prozessual, kulturell), um unsere Ziele zu erreichen?
• Welche Stärken stehen uns dafür zur Verfügung?
• Welche Defizite müssen wir ausgleichen?
• Welche Themen haben welche Priorität?
2.4 Vier Säulen-Schema Phase 4: Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung ableiten, Ergebnis-controlling gewährleisten
„Weniger ist mehr!“ Jede Einzelmaßnahme zur Umsetzung der Veränderungsziele ist ein „on top“ zum operativen Tagesgeschäft. Empfinden das die Mitarbeiter allzu sehr als zusätzliche Belastung, sind Widerstände wiederum vorprogrammiert. Da-her ist eine klare Priorisierung des Wesentlichen erforderlich.
Klärende Fragen:
• Welche konkreten Maßnahmen müssen wir einleiten? (Wer macht was bis wann?)
• Welche Ressourcen sind dafür erforderlich?
• Welche dieser Maßnahmen sind am erfolgversprechendsten?
• Wie ändern sich die aktuellen Prioritäten?
• Wie gewährleisten wir die Umsetzung bei laufendem Tagesgeschäft?
• Wann finden die Termine zum Ergebniscontrolling statt?
Tipp: Für die Umsetzung hat sich die Implementie-rung von (team-/gruppenübergreifenden) Arbeits-gruppen bewährt, die für Umsetzung bestimmter to do`s und für die Kommunikation der Ergebnisse in die gesamte Mannschaft verantwortlich sind. Je nach Thema sollten sich die Besetzungen der Teams verändern. So binden Sie alle Beteiligten ein und verhindern, dass sich eine Kerngruppe in ihrer Gesamtverantwortung von den anderen abkoppelt.
3. Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Umsetzung des Vier-Säulen-Schemas:
Da Schwierigkeiten und Konflikte „ganz normale“ Begleiterscheinungen sind, bedarf es neben der fachlich-sachlichen, der strukturellen und der pro-zessualen Betrachtungsweise insbesondere einer reflektierten Sicht auf die emotionale Ebene – in jeder der vier Phasen. Denn bei allen Zahlen, Daten, Fakten, die unabdingbar z.B. für die Definition zielführender Handlungsfelder sind, entsteht die wichtige Veränderungsenergie „im Bauch“ jedes Einzelnen.
Folgende Voraussetzungen müssen für eine Aufbruchsstimmung und die dauerhaft erfolgreiche Umsetzung der einzelnen Phasen des Vier-Säulen-Schemas gegeben sein:
3.1 Erfolgsfaktor „Commitment und Transparenz“
3.1.1 Der Vorstand/die Geschäftsleitung beteiligt sich aktiv an der Veränderungsmaßnahme, indem er seine Vorbildfunktion wahrnimmt durch
• ein klares Commitment zum Change
• das Festlegen der Eckpunkte für die zukünftige Veränderungs-/Unternehmenskultur
• Abstimmungsgespräche (Meilenstein-Meetings) mit der Projektleitung, um flexibel auf alle relevanten Themenstellungen (wie z.B. aktuelle interne Engpassthemen, Veränderungen im Markt oder Themen, die aus dem Changeprozess neu entstehen) reagieren zu können
Sie als Changemanager benötigen eine klar definierte Basisentscheidung, um die zweifelsfreie Rückendeckung „von oben“ zu haben. Auch als Entscheidungsrahmen für die wichtigen Folgeentscheidungen, die Sie für die Realisierung des Veränderungsprozesses treffen müssen.
3.1.2 Die notwendigen Interventionen müssen gekennzeichnet sein von
• hoher Orientierung an den Unternehmenszielen
• hoher Messbarkeit
• hoher Praxistauglichkeit
• hoher Umsetzungskonsequenz
• hoher strategischer Ausrichtung
• hoher Flexibilität (denn nicht alles lässt sich zu Beginn eines Prozesses zu 100 % planen)
3.1.3 Die Projektleitung bindet die Personalentwicklung frühzeitig ein, um die Anbindung erforderlicher Interventionen an bestehende Personalentwicklungsinstrumente zu gewährleisten (wie beispielsweise die Anpassung des Führungsstils der changeverantwortlichen Manager an vorhandene Führungsgrundsätze).
3.2 Erfolgsfaktor Rollenklarheit
„Rollenklarheit von Anfang an statt Dauerkon-flikt!“
Eine der Hauptursachen für Konflikte in Verände-rungsprozessen sind ungeklärte Rollen, Kompeten-zen, Aufgaben.
Erst wenn die Mitarbeiter erkennen, dass sie mit ihren Stärken weiterhin gefragt sind, werden/können sie Ihnen auf dem neuen Weg folgen. Stärken, für die sie all die Jahre bezahlt wurden und die sie auszeichneten. Solange der Mensch am Arbeitsplatz Zweifel an der Akzeptanz seiner Fähigkeiten hat, beklemmt ihn das Gefühl, in seiner Arbeit nicht anerkannt zu werden. Da er sich jedoch i.d.R. stark mit seiner Arbeit identifiziert, macht sich eine gefühlte Missachtung seiner Person breit, die nicht selten in Angst mündet.
Ihre Rolle in den gefühlt unsicheren Zeiten eines Changeprozesses ist vergleichbar mit der des Archi-tekten: Sie entwerfen den Plan, der den Mitarbeitern die neue Richtung vorgibt. Damit schaffen Sie Orientierung, die wiederum zur Sicherheit der Mit-arbeiter beiträgt – eines der Grundmotive für ein dauerhaft professionelles Arbeiten.
Merke: Geklärte Rollen schaffen Orientierung und geben Sicherheit! Bei aller Vision beachten Sie die Tradition, also das Potenzial aus „der alten Welt“, das für die „neue Welt“ nützlich ist.
3.3 Erfolgsfaktor „Kommunikationsstrategie“
Im Umkehrschluss zu den o.g. Erfolgsfaktoren scheitern die allermeisten Changeprojekte an der unzureichenden oder gar fehlenden Transparenz über Anlass, Ziele und Nutzen –an einer unzu-reichenden, durchgängig zielführenden, den Erfol-gen der einzelnen Etappenzielen angepassten Kommunikation über alle Hierarchiestufen, nach innen und nach außen (z.B. in die Fachbereiche).
Entwickeln Sie Ihre Kommunikationsstrategie – bezogen auf die bisherigen Ergebnisse/Erfolge, Misserfolge sowie auf die jeweilige Stimmung. Planen Sie den Zeitaufwand, den Sie dafür investieren müssen, ein. Mit der Art Ihrer Informations- und Kommunikationspolitik liegt es in Ihren Händen, ob die „Gerüchteküche brodelt“ oder Klarheit, Transparenz und Berechenbarkeit vorherrschen.
3.3.1 Hilfreiche Tipps:
• Auch hier bewährt sich der Blick ins Organigramm mit der Kennzeichnung der Kommunikationswege zu den unterschiedlichen Hierarchiestufen. Lassen Sie im Kernteam „Information und Kommunikati-on“ festlegen, wer wann mit welchen Informationen über welche Medien versorgt werden muss.
• Entwickeln Sie für sich selbst und in der Mannschaft immer wieder aufs Neue ein Gespür für eine zeitnahe, adressatengerechte Informationspolitik – frei nach dem Motto: Agieren statt reagieren – so viel wie möglich, nicht mehr als nötig (… und im Zweifel darf es eher etwas mehr sein) !
• Nutzen Sie die Kommunikation von Erfolgsmeldungen in alle Richtungen (und seien sie auch scheinbar noch so banal). Ein einfaches und wirksames Instrument, um die Motivation aufrecht zu erhalten ist die turnusmäßige gemeinsame Rückschau auf das bisher Erreichte.
• Holen Sie dazu auch immer wieder Feedback von den geprüften Stellen ein und leiten Sie dieses unge-filtert an Ihre Mitarbeiter weiter.
• Nutzen Sie für einfache, routinemäßige Informationen/Kernbotschaften (wie kleinere Erfolge, einfache Kommunikationsmethoden/-instrumente (z.B.: in jour fixen, Gruppenmeetings, auch `mal per email), und für Außergewöhnliches (große Erfolgsmeldungen, erreichte Etappenziele, positives Kundenfeed-back aber auch Manöverkritik) außergewöhnliche Methoden (wie Workshops, Meilenstein- und Kamingespräche).
3.4 Erfolgsfaktor „Kulturwandel“
Changeprojekte scheitern signifikant häufiger an den beschriebenen emotionalen Aspekten als an sachlich-fachlichen Gründen. Lassen Sie uns daher die Veränderung der Revisionskultur während des Gesamtprozesses besonders betrachten:
Strukturveränderungen können relativ schnell und deutlich vonstattengehen -insbesondere wenn die Entscheider in der Organisation mit entsprechen-dem Machtpotenzial ausgestattet sind. Das opera-tive Geschäft lässt häufig nichts anderes zu. Eine Veränderungen der Kultur hingegen bedeutet, Gewohnheiten Ihrer Revisionseinheit verändern zu wollen (die sich häufig über lange Jahre entwickelt haben). Es geht um nicht weniger als um die Art und Weise, in der Sie mit Ihren Mitarbeitern, diese mit Ihnen, diese untereinander und mit den Fachbereichen und Schnittstellen umgehen… Da wir in der Regel von dem was wir tun überzeugt sind, entpuppt sich die Kulturveränderung als ein sehr sensibler, hochemotionaler und häufig zeitintensi-ver Prozess. Wer jedoch die Kultur außer Acht lässt, gefährdet die Gesamtinvestition des Changeprozes-ses!
3.4.1 Das Kulturkreuz bietet Ihnen die Chance, die aktuelle Revisionskultur zu reflektieren, und die komple-xe Thematik „Kulturveränderung“ von IST nach SOLL operativ einzuleiten:
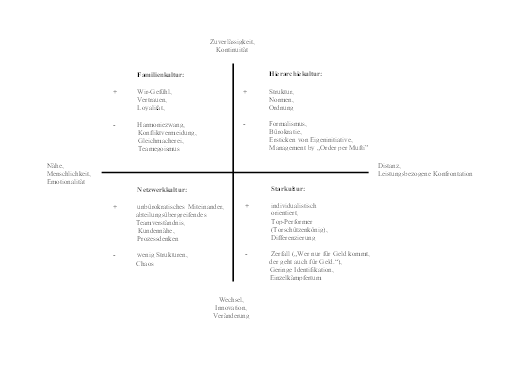
Abb. 3: Das Kulturkreuz, Quelle: swk OHG, Bad Homburg
Tipp: Bearbeiten Sie das Kulturkreuz top-down, binden Sie die Sichtweisen und Ideen der Mitarbei-ter besonders stark ein und gleichen Sie diese immer wieder mit Ihrer Bewertung und der des gesamten Managementteams ab:
Nachdem Sie selbst das Kulturkreuz bearbeitet haben, leiten Sie die Führungskräfte aus Ihrem Managementteam an, dies ebenfalls zu tun.
Gleichen Sie die Ergebnisse ab, schaffen Sie mög-lichst Konsens und leiten Sie daraus zunächst Maßnahmen für das Managementteam zur Reali-sierung der Soll-Kultur in der Internen Revision ab.
Danach lassen Sie die Gruppen/Teams ebenfalls das Kulturkreuz bearbeiten. Gleichen Sie deren Ergebnisse mit dem Konsens des Manage-mentteams ab und entwickeln Sie gemeinsam mit den Mitarbeitern Erfolgskriterien, anhand derer Sie die erfolgreiche, schrittweise Implementierung der neuen Kultur erkennen werden. Leiten Sie daraus weitere Maßnahmen ab (weniger ist mehr).
Ergebniscontrolling (!): Sichern Sie im Manage-mentteam, wer zu welchen Terminen die Überprü-fung vornimmt und in welchen Zeitabständen Sie die neue Revisionskultur immer wieder neu propa-gieren.
3.4.2 Hilfreiche Transferfragen:
Analyse Ist-Kultur
• Welche der genannten Kulturmerkmale aus den vier Quadranten kennzeichnen unsere aktuelle Kultur?
• Welche Merkmale kennzeichnen unsere IST-Kultur darüber hinaus?*
• An welchen konkreten Beispielen aus dem Tagesgeschäft erkennen wir diese Merkmale?
• Was genau wollen/müssen wir verändern?
Analyse Soll-Kultur
• Welche Kulturmerkmale wollen wir beibehalten?
• Welche müssen wir optimieren?
• Welche müssen wir neu hinzufügen?*
• Woran werden wir unsere Kulturveränderung zukünftig im Arbeitsalltag erkennen?
• Woran wird das unser Kunde zukünftig erkennen?
*Weitere Kulturmerkmale3 können sein:
• Offener Umgang untereinander
• Wissenstransfer ist selbstverständlich
• unternehmerische Verantwortung
• transparentes Agieren beim Kunden
• klare, adressatengerechte Kommunikation der Findings
• Unabhängigkeit
• Risikoorientierung
• durchgängig hohe Qualität
• professionelles Auftreten ggü. den Fachbereichen (Was genau bedeutet hier „Professionalität“?)
• professionell-kompetente Außenwirkung (Fragen Sie im Zweifel Ihre Kunden!) etc.
3 Vgl. Jan Kuhnert, Stephan Teuber:
Praxishandbuch Change Management, Kap. 15 Culture Follows Strategy, Abschnitt 15.2.2.2 Analyse der Ist-Kultur
Tipp: Nach anfänglich bewusst breit angelegtem Brainstorming über die Aspekte der neuen Kultur, sollten Sie diese priorisieren und auf einige wesentli-che Punkte reduzieren. Der konkrete Handlungsbe-darf zeigt sich erfahrungsgemäß sehr schnell, ein konkreter Maßnahmenplan für den Weg von IST nach SOLL drängt sich als logische Folge daraus förmlich auf.
3.4.3 Bewertungsschema Ist-Analyse
Für den Abgleich zwischen der IST- und der SOLL-Kultur entwerfen Sie bitte ein Bewertungsschema (so einfach wie möglich), das Ihnen die Defizite in der IST-Kultur auf einen Blick verdeutlicht und die Entwicklung eines kulturellen Anforderungsprofils (SOLL) ermöglicht, wie z.B.:
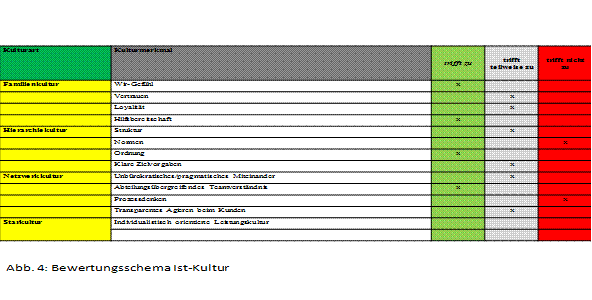
3.5 Erfolgsfaktor „Teamwork“
Jede Veränderung, jede Neubesetzung, jede neue Aufgabe hat Auswirkungen auf den dynamischen Prozess der Entwicklung einer Revisionseinheit als Team. Wertvolle Erkenntnisse über die aktuelle Identität und der Reifegrad Ihrer Abteilun-gen/Gruppen/Teams erkennen Sie in dem Vier-Stufen-Modell. Das Wissen um aktuell typische Vorgänge, typisches Verhalten, subjektives Erleben und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter ermöglicht Ihnen konkrete Maßnahmen abzuleiten, um die nächste Entwicklungsstufe dem aktuellen Status des Changeprozesses anzupassen.
Die Ausprägung der einzelnen Phasen ist sowohl von dem Ausmaß des Zusammenhaltes in der Gruppe wie auch von dem Umgang mit den inneren und äußeren Veränderungsfaktoren, die auf die Revision wirken, abhängig. Dabei kann der aktuelle Stand Ihrer Einheit durchaus Aspekte aus mehreren Stufen aufweisen.
3.5.1 Das Vier-Stufen-Modell „Teamidentität“
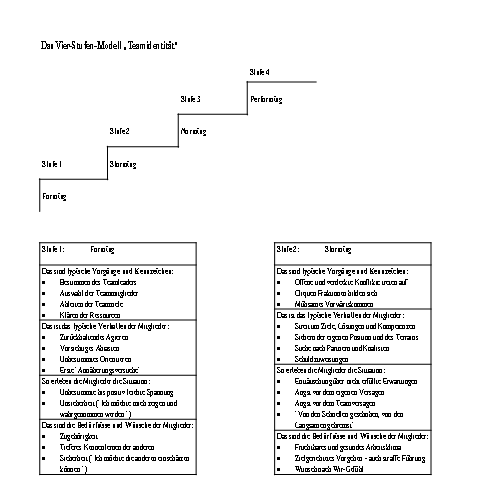
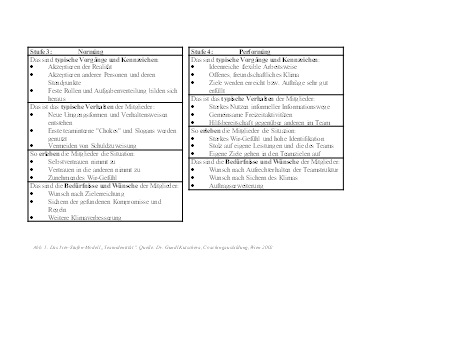
Hilfreiche Transferfragen:
• Auf welcher Entwicklungsstufe befindet sich Ihre Einheit aktuell?
• Welche Unterstützung brauchen Ihre Mitarbeiter zum jetzigen Zeitpunkt von Ihnen/den Führungskräften, um die nächste Stufe zu erreichen?
• Welche Erwartungen haben Sie diesbezüglich an Ihre Mitarbeiter?
• Welche konkreten Maßnahmen leiten Sie daraus ab?
Tipp: Die Beantwortung der Fragen im Dialog mit Ihren Mitarbeitern beflügelt den Prozess, in der Veränderung zu einem reiferen, in sich gefestigten Team zusammenzuwachsen.
3.5.2 Hilfreiche Transferfragen:
• Auf welcher Entwicklungsstufe befindet sich Ihre Einheit aktuell?
• Welche Unterstützung brauchen Ihre Mitarbeiter zum jetzigen Zeitpunkt von Ihnen/den Führungskräf-ten, um die nächste Stufe zu erreichen?
• Welche Erwartungen haben Sie diesbezüglich an Ihre Mitarbeiter?
• Welche konkreten Maßnahmen leiten Sie daraus ab?
Tipp: Die Beantwortung der Fragen im Dialog mit Ihren Mitarbeitern beflügelt den Prozess, in der Veränderung zu einem reiferen, in sich gefestigten Team zusammenzuwachsen.
3.5.3 Verknüpfung der beiden Erfolgsfaktoren „Kulturwandel“ und „Teamwork“
Möglicherweise werden Sie auf dem Weg von der IST-Kultur hin zur SOLL-Kultur dem Ausbau der Netzwerkkultur besondere Bedeutung beimessen. In Sachen Teamidentität streben Sie danach, möglichst rasch in die Performingphase zu gelangen. Das eine geht nicht ohne das andere: Gelebte Netzwerkkultur erfordert ideenreiche, flexible Revi-sionsteams, die ihr gesundes Selbstbewusstsein für einen professionellen Auftritt ggü. den geprüften Stellen nutzen… Eben solche Teams mit einer dau-erhaft hohen Performance können sich wiederum insbesondere in einer funktionierenden, gewollten und von dem Managementteam vorgelebten Netzwerkkultur entfalten.
3.6 Erfolgsfaktor Mitarbeiter-Know-how
Noch einmal zurück zu unserem Beispiel aus der Praxis:
Eineinhalb Jahre vor Beginn dieses neuerlichen Changeprojektes, bekam der Bereichsleiter den Auftrag vom Vorstand, die Prozesse in der Revision durchleuchten zu lassen, um sich im Sinne der neuen Anforderungen optimal aufzustellen. Der Bereichsleiter und die Abteilungsleiter entschieden, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu engagieren. Ziele der Maßnahme waren die Optimierung der Prozesse nach neuestem Revisionsstandard und die Implementierung eines modernen Revisionsverständnisses. Die Gruppenleiter hatten den Auftrag, das externe Expertenteam während seiner Bestandsaufnahme auf der Basis einer bis dato eher unvollständigen Prozessbeschreibung zu den aktuellen Prozessen zu briefen. Optimierungspotenzial war schnell erkannt. Am Ende sollte u.a. das „Prozesshandbuch Interne Revision“ als eine transparente, vollständige Prozessdokumentation erschaffen worden sein. Eine umfangreiche Arbeitsanweisung, nach der zukünftig gearbeitet werden sollte. Ein Standard, der die Einarbeitung neuer RevisorInnen erleichtern, die Qualität des Wissenstransfers optimieren und mittelfristig eine Jobrotation ermöglichen sollte.
In der Umsetzungsphase zeigten sich jedoch massive Widerstände der Mitarbeiter. Immer wieder wurde nach Fehlern und Problemen in der neuen Konzeption gefahndet statt Lösungen zu suchen und die Chancen zu erkennen. Aussagen wie „das ist doch nur alter Wein in neuen Schläuchen“ oder „warum soll das was Jahre lang gut war, jetzt alles schlecht sein“ häuften sich. Nervenaufreibende Reibungsverluste zwischen Managementteam und den Mitarbeitern waren an der Tagesordnung.
Obwohl die Veränderungsenergie von oben (Vorstand-Bereichsleiter mit Managementteam) vorhanden, die Investition in den Prozess fachlichsachlich allemal zu rechtfertigen war, die externen Spezialisten Optimierungsfelder identifizierten und professionelle Ideen entwickelten, wollte das Pro-jekt einfach „nicht fliegen“.
In einem der Umsetzungsworkshops, die die Identi-fikation der Mitarbeiter mit dem Neuen erhöhen sollte, kam eine Arbeitsgruppe zu folgender Kernbotschaft: „Hätte man uns mal gefragt, wären wir heute weiter!“
Was war also geschehen?
Die scheinbar destruktiven Reaktionen der Mitar-beiter offenbarten eines sehr deutlich: Die frühzeitige Einbindung der Mitarbeiter fand faktisch nicht statt! Weder mit einer durchgängig transparenten Information durch das Managementteam, noch durch das Abrufen des umfangreichen Know-hows der Mitarbeiter. Ein Widerspruch in sich: Sollten doch mit dem Veränderungsprozess ursprünglich transparente Strukturen geschaffen und der Informations- und Wissenstransfer gefördert werden…
Jetzt nach eineinhalb eher zähen Jahren im Span-nungsfeld zwischen Erwartungen und Umsetzungs-blockaden, sollte erneut ein Changeprojekt zur „Optimierung der Revisionsarbeit“ aufgesetzt werden – diesmal unter Einbeziehung der Mitarbeiter von Anfang an. Trotz dieser guten Vorsätze (die später auch tatsächlich realisiert wurden) lässt sich vorausahnen, wie hoch die anfängliche Motivation gewesen sein mag: Die Klimakurve startete nicht mit Neugierde, Vorfreude oder gar einer ersten Euphorie, vielmehr rauschte das Vorhaben von An-fang an in die besagte Konzeptkrise. Ein denkbar schlechter Start…
Merke: Die Managementleistung besteht darin, das Wissen der Mitarbeiter abzurufen. Im Gegensatz zu den üblichen Anforderungen an Ihre Entscheidungskompetenz, nehmen Sie hier bewusst eine fragende Haltung ein: Am Anfang einer guten Idee steht immer eine gute Frage!
3.7 Erfolgsfaktor „Changecontrolling“
Fünf Mindestanforderungen an ein professionelles Controlling im Changeprozess sind:
• Transparentes, erreichbares Gesamtziel.
• Transparente, erreichbare Etappenziele/konkrete Meilensteine mit klaren Terminvorgaben.
• Konkrete Maßnahmen, um die Etappenziele zu erreichen mit klaren Terminvorgaben.
• Vorausschau der Ergebnisse: Welche Ergebnisse sollen nach welchen Etappe (zu welchem Zeitpunkt) erzielt sollen worden sein?
• Rückschau: Welche Ergebnisse sind tatsächlich erzielt worden?
Die durchgängige Umsetzung des Controllings erfordert einerseits Disziplin. Andererseits die Fähig-keit, sich aus seiner aktiven Rolle im Changeprozess bewusst zu lösen und die erreichten Meilensteine aus dem Blickwinkel des unabhängigen Con-trollers (des Steuerers) sachlich aufzunehmen. Neben der unzureichenden Kommunikation (s.o.) ist ein schwaches Changecontrolling eine der wesentlichen Ursachen, an denen Veränderungsprojekte scheitern.
Merke: Erfolgreiches Changecontrolling bean-sprucht Zeit – bitte unbedingt einplanen!
4. Fazit:
Veränderungsprozesse, in die die Akteure hineinwachsen müssen, erfordern eine hohe Investition an Zeit und binden Ressourcen! Mit der Umsetzung jedes einzelnen der beschriebenen Erfolgsfaktoren dokumentieren Sie Ihre Managementkompetenz, indem Sie einen professionellen, ziel- und entwicklungsorientierten Veränderungsrahmen stellen.
Sie stärken Ihre Führungskompetenz durch transparente Vorgaben und klare Entscheidungen. Darüber hinaus erhöhen Sie die Problemlösekompetenz Ihres gesamten Verantwortungsbereiches und stärken das Selbstbewusstsein, etwas aus eigener Kraft bewegen zu können. Leistung und Qualität nehmen einen höheren Stellenwert ein und Veränderungen werden als Herausforderung angenommen und gemeinsam „gemeistert“.
Sie erhöhen das Standing Ihrer Einheit im gesamten Unternehmen, indem Sie Ihre Revision strategisch zu einem modernen Instrument der Unternehmensführung platzieren. Insbesondere, da die Interne Revision ihrerseits der Motor für Veränderungsprozesse in den Fachbereichen ist.

